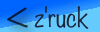
Auszug aus den Richtlinien zur Trachten- und Heimatpflege des Bayerischen Trachtenverbandes e. V.
Das erstrebenswerte Ziel heißt: die lebendige Tracht!
Die Pflege der bodenständigen Tracht ist deshalb die allererste Aufgabe
eines Trachtenvereins. Dazu gehören die Festtagstrachten in den historischen
und erneuerten Formen und die Trachtenbekleidung im Alltag. Die Tracht soll
in allen Bestandteilen ihre Echtheit und Sauberkeit aufweisen, in ihrer Gestaltung
der guten Sitten der Heimat entsprechen, soweit möglich in Handarbeit
hergestellt sein und in einwandfreier, dazupassender Haartracht in Würde
getragen werden.
Wir sollen also nicht nur unsere Vereinstracht, die auch Festtracht und Kirchengewand
ist, pflegen und erhalten, sondern auch darüber hinaus am Trachtengewand
festhalten. Bei einem privaten Dirmdlgwand oder einem Laibl z. B. kann man
persönliche Farb und Stoffwünsche einfließen lassen. Natürlich
soll man schon an den Richtlinien der Oberpfälzer Tracht festhalten.
Als Gautrachtenwartin komme ich zwangsläufig bei Sitzungen uns Verbandstreffen
mit dem Landesverband in Berührung. Da fällt mir immer auf, dass
jede ein Dirndlgwand und die Männer ihre Tracht anhaben. Jede Frau und
jedes Moidl hat die Haare geflochten oder hochgesteckt, also sauber frisiert.
Bei Gauversammlungen greift dieses Vorbild noch, doch bei Seminaren tragen
oft nur die Referenten ihr Trachtengwand.
Wie schaut es in den Vereinen bei Versammlungen aus? Bei der Jahreshauptversammlung
tragen alle ihre Vereinstracht, weil man sonst vielleicht nur Landhausmode
hat. Und bei den Tanzproben der Erwachsenen und der Jugend sowieso nur Jeans
und Co. Bei den Mädchen oft Jeans bauchfrei und Top bauchfrei. Also Alltagskleidung!
Schade, dass wir keine Alltagstracht haben, neben unserer Vereinstracht, die
ja nun mal, nicht zuletzt wegen ihrer wertvollen und aufwendigen Verarbeitung,
unser Fest- und Kirchengewand ist. So eine Tanzprobe im Dirndlgwand und die
Boum in Lederhosen, oder zumindest in einem Leibl und einem weißen Hemd,
wirkt ganz anders und hebt es vom Alltag, der Arbeits- und Schulwelt ab. Jeder
Fußballer hat auch beim Training sein Fußballdress an und jede
Tennisspielerin ihr Tennisröckchen an.
Wenn wir Trachtengwand tragen, sind wir immer richtig angezogen und fallen
so (ich hoffe doch) positiv auf. Denn wer anders ausschaut zieht die Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit auf sich. Wir sind nicht nur Trachtler, sondern
„leben“ auch Tracht und steigern unsere Glaubwürdigkeit,
auch in den eigenen Reihen und vor allem bei unserer Jugend. So leisten wir
nebenbei noch Öffentlichkeitsarbeit und vielleicht können wir so
den einen oder anderen davon überzeugen, dass Trachtenverein mehr ist,
als 2 – 3 mal im Jahr in der Tracht bei der größten Hitze
durch den Ort zu latschen.
ZUR HAARTRACHT UND -MODE
Ausser bei Kleiderverordnungen der Obrigkeit, wird meist, so nehme ich an,
die vornehme Gesellschaft auf Bildern, Fresken, Kupferstichen und dergleichen
beschrieben, weil arme Leute wohl kaum abgebildet wurden. Erst später
wurde die Kleidung der ländlichen, ärme-ren Bevölkerung auf
Votivtafeln o. ä. dargestellt
Im Mittelalter 1150 – 1550 trug die Frau ihr Haar lang, von unverheiratete
Frauen entweder offen oder zu Zöpfen geflochten. Ab dem 13. / 14. Lebensjahr,
wenn die jungen Damen verheiratet wurden, wurde das Haar unter verschiedenen
Kopfbedeckungen (Gebende und Schleier) verborgen. Manchmal steckten sie die
Haare einfach hoch und bedeckten sie mit einer gewöhnlichen Haube.
Der Mann trug sein Haar meist kurz mit verschiedenen Kopfbedeckungen, bevorzugt
Gugel, eine am Kragen befestigte Kapuze, aber auch Bundhaube, Stohhüte
und Mützen. (Zusammenfassung im Intenet von Schülerinnen im Rahmen
eines Unterrichtsprojekts)
Im Buch "Tracht in der Oberpfalz" heißt es zum Frauenhaar,
nach graphischen Darstellungen Albrecht Dürers, um 1495: Das Haar ist
zu einer elegant aufgesteckten Zopffrisur geformt. Bei der kaiserlichen Kleiderordnung
1530 heißt es u. a., als alles Gold, Silber und Seide dem Bauersmann,
Arbeitsleut und Tagelöhner auf dem Lande verboten war: ... allein mögen
ihre Töchter und Jungfrauen ein Haarbändlein von Seide tragen.
Im Zeitalter der Spanischen Mode 1550 – 1670 sind in diesem Buch nur
Kopfbedeckungen beschrieben. Z. B. vom schmalem spanischen Hut bis zum breitkrempigen
Hut aus der Sol-datenkleidung des 30-jährigen Krieges, beim Mann und
bei der Frau eine Kopf, bzw. das Haar umschließende Haube unter dem
Hut aus Filz und Pelz. Lediglich bei ledigen Mädchen steht, dass sie
auch zu diesem Zeitpunkt das kreuz- oder wulstförmige Haarband trugen,
für das die bayerische Kleiderordnung von 1604 Seide und Samt ausdrücklich
zulässt.
1670 – 1800 (Barock) wird das männliche Haar schon ausführlicher
beschrieben. Die Perücke (Zopfperücke) gehört zur rein bürgerlichen
Kleidung. Im allgemeinen wird das Haar nicht ganz schulterlang getragen, die
Vorderpartie kann dabei in die Stirn gekämmt
oder zurückgestrichen sein, wobei das Haar durch einen Kamm auf dem Wirbel
gehalten werden kann. Der Physikatsbericht Parsberg beschreibt für die
älteste Trachtenschicht, also etwa um die Zeit um 1800, die Frisur folgendermaßen:
"Haar von der Stirn nicht ganz bis in den Nacken geschoren. Vom Hinterhaupt
mussten sie die Schultern bedecken." Das Ein-stecken eines Kammes, um
das Vorfallen des Haares bei der Arbeit zu verhindern, wird in diesem Funktionsbezug
behandelt.
Bei den Frauen wird sehr ausführlich die Rokokohaube (Grundform
unserer Bänderhaube), beschrieben und erklärt, es ist auch die Rede
vom weißen Kopftuch. Zu den Haaren steht dann: Im allgemeinen tragen die
Unverheirateten ihre eigene Haartracht, nähmlich entweder das bloße
Haar oder einen Kranz. Im ersteren Fall ist das Haar meist straff aus der Stirn
nach rückwärts gekämmt, fast durchwegs in einen Knoten gebunden,
der mit eingeflochtenen Bändern geschmückt ist. Soweit zu beobachten
sind die Bänder bezeichnenderweise rot. Etwas häufiger ist der Kranz
nachzuweisen: zwischen 1701 und 1799 ergeben sich 11 Be-lege. Wo eine genauere
Interpretation der Quellen möglich ist, zeigt sich, dass er über dem
geschilderten Haarknoten am Hinterkopf getragen wird.
Bei dem Kranz handelt es sich offensichtlich in der weiteren Beschreibung im
Buch um das "Kranl", jene spitz-ovalen, mit Perlen, Glassteinen, Metallbouilon
und Flitterwerk besetzten, kleinen, etwa 5 – 7 cm hohen, ca. 15 –
20 cm langen, nach oben leicht verjüngenden Reifen, die über dem Haarknoten
getragen und oft mit großen Quernadeln festgesteckt wurden.
Jetzt kommen wir zum 19. Jahrhundert, aus dem zum größten Teil unsere
Tracht abgeleitet ist, auch in den erneuerten Formen.
Bei der Trachtenbeschreibung um Bruck und Roding liest man: Näheres über
die Haartracht der Männer in dieser Landschaft erfahren wir bei Fentsch,
der u. a. die Oberpfälzer Volkstracht um 1865 beschrieben hat. Das vom
Wirbel aus nach allen Richtungen glatt gestrichene, längs der ganzen Stirnbreite
kurz und gerade zugestutzte, an den Schläfen länger herabwallende
Haupthaar gibt seinem Kopf noch den mittelalterlichen Zuschnitt. Laut Physikatsbericht
trägt der Mann im Bezirk Burglängenfeld die Haare kurz abge-schnitten.
Bei den Frauen werden die verschiedenen Bänderhauben beschrieben. ...Die
Haube wird, wie es auch der Burglengenfelder Physikatsbericht beschreibt, auf
der Kopfmitte über dem Scheitel in einem Knoten zusammengefassten Haar,
getragen. Bei einer kleineren Haube, die in Wiesau getragen wurde, heißt
es; diese Haube wurde auf dem Scheitel getragen, ein schmales Gummiband hielt
sie hinten und an dem zum Knoten geflochtenen Haar, ein weiteres verlief hinter
dem Ohr und unterhalb des Kinns. An anderer Stelle wird von einem Kopftuch gesprochen,
dass in der Diagonale zusammengeschlagen, über den Kopf geworfen und hinten
gebunden wird, so dass es dem ganzen Haupte sich anschmiegt. Vorne reicht es
bis an die Stirne und lässt vom Haare wenig sehen. Im Physikatsbericht
von Kemnath ist noch zu lesen: Um den Kopf winden sie große viereckige
Tücher von buntem, braunem wollenem Zeuge... Das Haar wird darunter bis
zum Hinterhaupt zurückgestrichen, oder am Scheitel in einem Knoten befestigt.
Leider wird sonst das Mädchen- oder Frauenhaar um diese Zeit nicht näher
beschrieben, vor allem dann, wenn keine Kopfbedeckung getragen wird. Es lässt
sich aber daraus schließen, dass es immer geflochten oder zu einem Knoten
am Hinterkopf, auf jedem Fall nach hinten frisiert war.
Dies sind einige Punkte zur Haartracht, die sich bei den Beschreibungen der
Kleidung und Tracht finden lassen. So ändert sich die Haarlänge der
Männer von kurz im Mittelalter, schulterlang im Barock und wieder kurz
im 19. Jahrhundert, während das Frauen- und Mädchenhaar immer lang
bleibt. Jedoch ist es immer unter Haube oder Tuch zusammen-gefasst, oder glatt
oder geflochten zu einem Knoten frisiert.
Gertraud Kerschner
Trachtenwartin Gauverband Oberpfalz